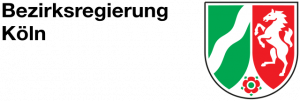Text - Arminius-Rezeption seit dem 15. Jahrhundert
Nach fast anderthalb Jahrtausenden war es dann allerdings kein schöner Prinz, der gezielt eine Schönheit aus dem Schlaf küsste, sondern ein gestrenger Gelehrter, der bei seiner harten Arbeit mehr oder weniger zufällig über die Schlummernde stolperte: Ulrich von Hutten stieß 1515 bei einem Studienaufenthalt in Rom auch auf die ersten Bücher der Annalen von Tacitus, die erst einige Jahre zuvor wiederentdeckt worden waren. Darin war von einem heldenhaften Arminius die Rede, der einst das Römische Reich in der Blüte seiner Macht besiegt habe; »unstreitig war er der Befreier Germaniens«, behauptete dieser Tacitus.
Dem Humanisten war ein Schatz in die Hände gefallen: Die positive Schilderung von Arminius aus römischer Sicht war ein gutes Argument gegen die demonstrative Geringschätzung der »Deutschen«. Italienische Humanisten und römische Kurie übten sich ja genüsslich in der Vorstellung, nördlich der Alpen lebten noch immer hauptsächlich Barbaren. Da wollten Ulrich von Hutten und andere mit einer eigenen ruhmreichen Geschichte kontern – und so modellierte Hutten den ersten deutschen Helden: In seinem 1529 posthum veröffentlichten Dialog Arminius präsentierte er einen edlen Freiheitskämpfer, der stets nur daran dachte, wie er »dem Vaterland bei sich bietender Gelegenheit helfen könnte«.
Mehr als 200 Schauspiele und Opern entstehen um den Helden Arminius
Das war der Auftakt zu einer Erfolgsgeschichte: Als Befreier Germaniens (die unhistorische Gleichsetzung von Germanen und Deutschen setzte sich rasch durch) erschien Arminius nun als nationale Lichtgestalt gegen jedwede äußere Bedrohung. Bei Hutten war es der antirömische Impuls: Die »Befreiungstat« des Cheruskers war Vorbild für die Befreiung vom römischen Papst (das erklärt, warum Arminius bis ins 20. Jahrhundert hinein in erster Linie ein protestantischer Held blieb). Und auch Martin Luther hatte den Cherusker »von hertzen lib« – aus dem reformatorischen Milieu stammte zugleich der neue, unhistorische Name für den Helden: Hermann.
Die Germanenbegeisterung im 18. Jahrhundert griff die Idealisierung von Arminius auf und brachte den nationalen Helden auch auf die Bühne: Mehr als 200 Schauspiele und Opern entstanden zwischen 1750 und 1850, in denen es vor allem um Hermann, aber beispielsweise auch um seine getreue Gemahlin Thusnelda ging (die einst schimpflich verraten und den Römern als Geisel ausgeliefert worden war). Im Vordergrund stand vor allem die Rehabilitierung der Germanen – sie sollten nicht länger als rückständig oder gar barbarisch erscheinen. Tatsächlich hätten sie sehr wohl Sinn für Theater oder Baukunst besessen, erklärte beispielsweise Justus Möser. Mehr noch: Bei der Kleidung, so behauptete der Osnabrücker Gelehrte, hätten sie sogar einen besseren Geschmack als die so viel gelobten Römer bewiesen.
Auch andere beteiligten sich an den Lobeshymnen auf »Hermann den Befreier«. Friedrich Gottlieb Klopstock oder – mit der größten Wirkung – Heinrich von Kleist. Als Dramatiker der Befreiungskriege stellte er den historischen Arminius mitten hinein in den aktuellen Kampf gegen Napoleon. Die Beteiligten seines Dramas waren leicht zu entschlüsseln: Gegen die Römer (die Franzosen) erhoben sich die Cherusker (Preußen) gemeinsam mit den Sueben (Österreichern), während die uneinigen Germanenfürsten früherer Zeiten von den Rheinbundstaaten der Gegenwart gegeben wurden.
Bei der um sich greifenden Begeisterung für »Hermann den Cherusker« und die Lust an nationalen Denkmälern im 19. Jahrhundert war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann dem »Befreier« ein eigenes Monument gesetzt würde. Es entstand bekanntlich bei Detmold auf den Höhen des Teutoburger Waldes. Der Koloss – vom Sandsteinsockel bis zur Spitze des in den lippischen Himmel ragenden Bronzeschwertes über 50 Meter hoch – wurde 1875 eingeweiht, fast noch rechtzeitig zum Sieges- und Einheitstaumel des neuen Kaiserreichs. »Hermann« war jetzt ein willkommenes Symbol für den Sieg über den verhassten Erbfeind.
Dabei hatten sich die Freunde des Hermannsdenkmals mit dem Bau schwergetan – Karl Marx spottete schon: »Das Zeug wird ebenso langsam fertig wie Deutschland.« Bereits 1838 war mit den Ausschachtungsarbeiten begonnen worden, vorangetrieben von dem fränkischen Baumeister Ernst von Bandel. Der Eigenbrötler, seit jungen Jahren besessen von dieser Idee, musste Jahrzehnte für »sein« Hermannsdenkmal kämpfen. Streitereien mit örtlichen Honoratioren und der allgegenwärtige Geldmangel ließen die Arbeiten immer wieder stocken.
Der Arminius-Mythos fungierte nach außen zunächst einmal als Drohgebärde – nach innen war er ein probates Mittel zur Ausgrenzung innenpolitischer Gegner. Das galt etwa für die Katholiken: Die Enthüllung des Hermannsdenkmals fiel mitten in die Zeit des Kulturkampfs zwischen Staat und katholischer Kirche – und Arminius feierte als historischer Kämpfer gegen Rom protestantische Urständ. »Gott sei es geklagt«, rief der lippische Generalsuperintendent bei der Einweihung entrüstet aus, »dass es noch Deutsche gibt, denen die Herrlichkeit des Deutschen Reiches ein Dorn im Auge ist.«
Wo und wann immer fortan ein selbst definierter Feind der deutschen Sache auftauchte – und für die notorisch unsichere Nation war die Welt ja voller neidischer Feinde –, sah man in ihm einen neuen Varus. Diese »Varusse« konnten Franzosen sein, Juden, Katholiken oder Sozialisten – das Zeug zum »Varus« hatte jeder, der nicht in den Mainstream der Zeit passte.
Dass dieser nationale Streiter auch im Ersten Weltkrieg und der Weimarer Republik seine Rolle spielte, kann da nicht überraschen. »Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war«, rief Wilhelm II. 1914 dem in Wirklichkeit gar nicht so begeisterten deutschen Volk zu – und bemühte ebenjenen Mythos von der Einheit, der auch den Arminius-Kult groß gemacht hat. Hermann und mit ihm Heinrich von Kleists Hermannsschlacht erfuhren neue Beliebtheit: Nach einer Aufführung in Berlin wurden im Herbst 1914 von der Bühne herab Siegesmeldungen von der Front verlesen – das Schlachtfeld der Varusschlacht ging eine eigentümliche Symbiose mit den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs ein.
Mit der Kriegsniederlage war die Zeit des Arminius-Mythos keineswegs vorbei: In der vergifteten Atmosphäre nach 1918 stand Hermann getreulich im Lager der Republikfeinde. Problemlos assistierte er etwa bei der Verbreitung der Dolchstoßlegende. Für viele Rechte wusste schließlich niemand besser als der Cherusker, was es heißt, im Felde unbesiegt zu sein, aber daheim unter dem Dolche der »Meuchelmörder« zu sterben. Und dass am Hermannsdenkmal gegen das »Diktat von Versailles« gewettert und mit einer neuen Varusschlacht gedroht wurde, versteht sich da von selbst. »Die Aufgabe, die sich Armin stellte«, behauptete dort etwa der Vorsitzende des Deutschen Sängerbundes 1924, »ist heute auch die unsrige.«
Angesichts solcher Äußerungen war es für die Nationalsozialisten nicht schwer, »Hermann« in ihre Reihen aufzunehmen. NS-Ideologe Alfred Rosenberg erweiterte den Arminius-Mythos um rassistisches Denken und zählte alte wie neue »Feinde« der Deutschen auf, die sich »in den Leib Germaniens eingefilzt« hätten. Und in den Geschichtsbüchern lasen die Schüler nach 1933, dass Arminius dereinst »die Reinheit des deutschen Blutes« gerettet habe.
Der Wunsch vor allem lokaler Streiter rund um das Detmolder Hermannsdenkmal, Arminius zum zentralen Heroen der neuen nationalsozialistischen Zeit zu erheben, ging indes nicht in Erfüllung. Für zentrale NS-Kundgebungen war die Waldlichtung um das Denkmal zu klein (und vermutlich viel zu abgelegen), und nicht zuletzt seit Bestehen der Achse Rom–Berlin musste man außenpolitisch auch auf Benito Mussolini Rücksicht nehmen: Als dieser 1936 zu einem Staatsbesuch anreiste, kam aus der Reichskanzlei die Anweisung, das Hermannsdenkmal aus dem offiziellen Besuchsprogramm auszusparen.
Nach 1945 schien Arminius als deutscher Geschichtsmythos nachhaltig beschädigt zu sein, sinnbildlich dafür stand das von Alliierten beschossene und beschädigte Hermannsdenkmal. Doch der nationale Held erfuhr eine überraschend schnelle Wiedergeburt: »Auferstanden aus Ruinen« hieß es für ihn nämlich in der jungen DDR. Arminius passte hervorragend zum realsozialistischen Blick in die Geschichte und ihre Gesetze. Vor allem, wenn es für die offizielle DDR-Geschichtsschreibung um »die Rolle der germanischen Stammesverbände bei der revolutionären Überwindung der Sklavenhaltergesellschaft« ging.
Unterstützung fand man bei den sozialistischen Klassikern. Für Friedrich Engels war Arminius »ein großer Staatsmann und bedeutender Feldherr« gewesen, während sich um den Statthalter Varus ein »Schwarm von Sachwaltern und Ferkelstechern« versammelt hätte, »reine Gurgelschneider«, die nur die »Aussaugung des Landes« im Sinn gehabt hätten. Und das alte Germanien erschien in seiner ökonomischen Verfassung geradezu vorbildlich: Grund und Boden seien vor allem Gemeineigentum gewesen, und jeder Germane hätte in seiner Freiheit nur dort seine Grenzen gefunden, wo er auf einen gleichberechtigten Partner getroffen sei – es existierte nach Engels eben »ein freies Ding, wo Genossen den Genossen richten«.
Wenn also die Germanen, so gesehen, »Genossen« waren und sich über »urkommunistische Eigentumsverhältnisse« freuen durften, war Arminius zwangsläufig der rechte politische Kämpfer für Ost-Berlin. Als 1957 Kleists Hermannsschlacht im Rahmen der Deutschen Festspiele des Harzer Bergtheaters auf die Bühne kam, gab das Begleitheft den Besuchern die politisch korrekte Erklärung. »Rom: das ist uns Amerika«, hieß es da, und die von Rom aufgestachelten und verfeindeten Stämme Germaniens seien »die deutschen Arbeiter in West und Ost«.
Gegen so viel lustvolle politische Inanspruchnahme hatte Westdeutschland kaum etwas zu bieten. Abgesehen von nationaltümelnden Feiern der FDP am Hermannsdenkmal, zu denen seit 1954 im Gedenken an den 17. Juni 1953 zu kernigen Sprüchen vom Vorsitzenden Thomas Dehler und lodernden Fackeln im Schatten des Teutoburger Waldes Zehntausende den Weg zu Hermann fanden (und die Rückgabe der Ostgebiete forderten), blieb es um den Helden früherer Tage still. Auch Claus Peymanns aufsehenerregende Inszenierung von Kleists Hermannsschlacht am Bochumer Schauspielhaus 1982 änderte daran wenig.
Als die Mauer fiel, trafen west- und ostdeutsche Arminius-Traditionen aufeinander, doch erwuchs daraus keine Neuinterpretation des alten Mythos. Vielmehr vollzog sich in geschichtspolitischer Perspektive so etwas wie ein Anschluss: Die Ostdeutschen legten den ideologischen Ballast weitgehend ab, der in der DDR über Jahrzehnte mit Arminius und seiner Freiheitstat gegen den fremden Bedrücker aufgebaut worden war. Und das Hermannsdenkmal blieb, was es schon in der alten Bundesrepublik gewesen war: eine Touristenattraktion.
Nach wie vor tobt der Streit um den wahren Ort der Schlacht
Die Geschichte um den Arminius-Mythos hätte damit beendet sein können, wäre es nicht einem Offizier der britischen Armee im Osnabrücker Land 1987 gelungen, Relikte einer römisch-germanischen Schlacht aus dem torfigen Boden zu ziehen. Als Archäologen weitere Überreste fanden, sah sich die Öffentlichkeit zu Beginn der 1990er Jahre mit einer längst vergessenen Frage konfrontiert: Wo fand die Varusschlacht wirklich statt?
Seit Jahrhunderten hatte diese Suche seltsame Blüten getrieben; Wissenschaftler und Provinzforscher stritten sich um die Wette, Dorflehrer fanden immer wieder Beweise für den wahren Ort des Geschehens, und Dichter trieben längst ihren wohlfeilen Spott mit den Suchenden. Theodor Mommsen stöhnte über die »deutschen Localforscher«, die nichts anderes zu tun hätten, als »mit den beliebten patriotisch-topographischen Zänkereien die kleinen und großen Klatschblätter zu füllen«.
Doch es war Theodor Mommsen selbst, der in der erneut ausbrechenden Debatte als Zeuge aufgerufen wurde. Schließlich hatte er aufgrund zahlreicher Münzfunde bereits 1885 das Fleckchen Kalkriese nördlich von Osnabrück zum wahrscheinlichsten Ort der Varusschlacht erklärt. Und dort fand man nun mehr und mehr Indizien für einen gewaltigen Waffengang. Seither haben – wie zu seligen Mommsen-Zeiten – die »patriotisch-topographischen Zänkereien« wieder Konjunktur.
Dass Kalkriese derzeit bei der Debatte um die Örtlichkeit die Nase vorn hat, ist dabei eigentlich nur die zweitwichtigste Erkenntnis. Die wichtigste ist: Dort entstand ein Forschungsstandort, der die Erschließung eines antiken Schlachtfeldes und die Vermittlung dieses Wissens ermöglicht. Das zählt. Wenn trotzdem die Zänkereien weitergehen, hat das auch etwas Gutes: Solange alte und neue Anhänger von Arminius ihre Energie mit ihren Gefechten um den richtigen Ort vergeuden, bleibt uns zumindest erspart, dass sie »Hermann den Befreier« wieder für aktuelle politische Fragen reanimieren.
2009 feiert Deutschland gleich mehrere nationale Jubiläen: die Varusschlacht, die Gründung der Bundesrepublik (und der DDR) sowie den Fall der Mauer. Einigkeit und Recht und Freiheit werden die alles beherrschenden Themen sein. Da bietet sich die Figur des Arminius-Hermann als geschichtspolitische Spaßbremse an: Die mit ihm transportierte Forderung nach deutscher Freiheit war immer auch eine aggressive Geste gegen äußere Feinde. Und der mit ihm verknüpfte Appell an die Einigkeit oft eine unerbittliche Kampfansage an »Abweichler«. Wer Arminius heute wieder hochleben lässt, sollte dies bedenken. Der Held, der so vielen Herren diente, hat keine saubere Weste.
Der Autor ist Historiker und lebt in Hamburg. Mehr zum Thema in seinem Buch das in der nächsten Woche im C. Bertelsmann Verlag erscheint (272 S., 19,95 €)